Der Österreichische Gedenkraum
25.05.2020
In Vorbereitung der Eröffnung der Mahn- und Gedenkstätte im Jahre 1959 waren die Lagergemeinschaften der Länder gebeten worden, Erinnerungen an die Zeit im Konzentrationslager aufzuschreiben und persönliche Gegenstände aus dieser Zeit für ein Museum zur Verfügung zu stellen. Es wurde angeboten, dass jede nationale Häftlingsgruppe nach eigenen Vorstellungen eine Zelle im ehemaligen Bunker ausgestalten könne.
Über das Treffen ehemaliger Ravensbrücker Häftlinge am 17./18. November 1956 in Berlin berichteten Bertl Lauscher und Toni Bruha ihren Kameradinnen in der Österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück (ÖLGR). Beide waren von der ÖLGR für das Internationale Ravensbrück Komitee als Delegierte benannt worden. Sie informierten darüber, dass der ehemalige Bunker des Lagers Ravensbrück das Museum aufnehmen solle. Im Mitteilungsblatt der ÖLGR vom Juli 1957 hieß es:“ Wir haben … für das Museum, d. h. für die Ausgestaltung unserer Zelle im Museum eine Kommission gebildet. Diese Kommission hat die Aufgabe, alles zu sammeln, was in Österreich überhaupt aufzufinden ist …: Erlebnisberichte aus dem Lager, Bilder von Verstorbenen und Hingerichteten und ihre Lebensbeschreibung, Gedichte, Fotos, Lieder, Zeichnungen und Plastiken, also Dinge, die im Lager entstanden sind. Weiters Erinnerungsstücke, wie Kleider und Wäsche aus dem Lager, Nummern, Winkel, Schuhe, Pantoffel, Essgeschirr, Andenken aller Art. … Außerdem ersuchen wir die Kameradinnen, uns Namen von Künstlerinnen bekannt zu geben, die in der Kommission mitarbeiten möchten.“ ¹
Als Ansprechpartnerin für Fragen zur Ausstellung wurde Hilde Zimmermann bestimmt. Weitere Mitglieder der Kommission waren Toni Bruha, Hanna Sturm, Bertl Lauscher und Valerie Tartar. Die inhaltliche Konzipierung, die Auswahl der Ausstellungsgegenstände, der Fotos und der Texte beschäftigte die Frauen der ÖLGR in den folgend zwei Jahren über alle Maßen. Gemeinsam mit der Architektin Margarete (Grete) Schütte-Lihotzky wurde ein Konzept für die Gestaltung des Museums erarbeitet, in der Hoffnung, dass „in der uns zugedachten Stelle im Bunker eine würdige österreichische Gedenkstätte errichtet wird.“ ²
Für die Einrichtung dieser österreichischen Gedenkstätte standen der ÖLGR zwei Zellen im ehemaligen Bunker zur Verfügung. In der ersten wurden die „Naziumtriebe in Österreich vor 1938“ sowie der Einmarsch der Deutschen in Österreich dargestellt. Auf einer Landkarte Österreichs wurden die Regionen des Widerstandes gezeigt. Besonders hervorgehoben wurde hierbei die Rolle der Frauen im Kampf gegen Faschismus und Krieg, beispielhaft dargestellt anhand der Geschichte zweier Widerstandskämpferinnen aus der Steiermark (Mathilde Auferbauer und Johanna Rainer). Die zweite Zelle war den österreichischen Todesopfern von Ravensbrück gewidmet. Exemplarisch wurden zehn ermordete Kameradinnen mit ihren Biographien vorgestellt. Die Ausstellung stellte außerdem das Konzentrationslager in seiner Struktur und seinen Funktionen vor, zog anhand von Zahlen und Fakten Bilanz über Faschismus und Krieg und mündete in dem Friedenswunsch der österreichischen Frauen der ÖLGR. Grete Schütte- Lihotzky und Hilde Zimmermann kümmerten sich persönlich um die richtige Präsentation der Ausstellungsstücke und -tafeln vor Ort.
Um vielen Österreichern und Österreicherinnen die Möglichkeit zu geben, sich über die faschistischen Greueltaten in Ravensbrück zu informieren, wurde eine Kopie der Ausstellung angefertigt, die jahrelang als Wanderausstellung sehr erfolgreich in Österreich gezeigt wurde. Aufgrund der Erfahrungen, die die Ravensbrückerinnen bei ihren Führungen durch die Ausstellung gemacht hatten, gab die ÖLGR im Jahr 1963 eine Broschüre zum Ausstellungsinhalt mit dem Titel: „Was geht das mich an“ heraus. Am 12. September 1959 wurde die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück feierlich eröffnet. Delegationen, bestehend aus ehemaligen Häftlingsfrauen und ihren Angehörigen aus vielen Ländern, nahmen daran teil.
In den Folgejahren waren die von den Ravensbrück-Überlebenden gestalteten Räume im ehemaligen Zellenbau (Bunker) ein herausragender Anlaufpunkt für Besucherinnen und Besucher der Mahn- und Gedenkstätte, darunter viele Jugendliche. Sie zeigten nicht nur das Grauen und Leiden im Konzentrationslager, sondern auch, wie die Häftlinge versucht hatten, unter extremen Bedingungen solidarisch miteinander umzugehen und dem unmenschlichen faschistischen Regime ihre Menschlichkeit, ihre Würde, ihren Widerstand und ihren Überlebenswillen entgegenzusetzen. 1985 wurde der ehemalige Zellenbau überschwemmt. Teile der Ausstellung wurden zerstört, auch viele österreichische Exponate waren unwiederbringlich verloren. Mitglieder der ÖLGR konnten nur einige wenige Dinge aus dem Schlamm bergen. Der Aufbau einer neuen Ausstellung wurde unumgänglich. Abermals wurden alle Kameradinnen in Österreich gebeten, den Neuaufbau der Gedenkräume mit Erinnerungsstücken zu unterstützen. Hilde Zimmermann war wiederum maßgeblich an der Vorbereitung der Ausstellung beteiligt. Das Konzept der ersten Ausstellung wurde im Wesentlichen beibehalten, einige weitere Inhalte wurden ergänzt. Als Zeichen des Zusammenhalts und der internationalen Solidarität im Lager wurde über die Kinderweihnachtsfeier im Winter 1944 berichtet.
Unterstützung erhielt sie dieses Mal vom Architekten Prof. Ernst Fuhrherr, der die grafische Gestaltung übernahm. Ihre neu gestalteten Gedenkräume konnte die ÖLGR, nur etwa anderthalb Jahre nach der tragischen Überflutung, am 19. September 1986, einer großen Delegation aus Österreich, allen voran die Obfrau der ÖLGR, Rosa Jochmann, präsentieren.³
Rainer Mayerhofer, der für die Arbeiter-Zeitung berichtete, charakterisierte die Ausstellung als „eindrucksvolle Dokumentation, die den Aufstieg des Faschismus in Österreich, von den hausgemachten Anfängen bis zum grausamen Naziregime, darstellt.“ Von ihm stammen auch einige Fotos von diesem Ereignis. Die Österreichische Lagergemeinschaft und Freundinnen (ÖLGR/F) geht davon aus, dass die Nationale Mahn- und Gedenkstätte auch künftig dafür Sorge tragen wird, dass die österreichischen Gedenkräume unverändert auch für die nächsten Generationen der BesucherInnen authentisch erlebbar bleiben – so, wie sie die überlebenden österreichischen Ravensbrückerinnen konzipiert und aufgebaut haben.
Anlässlich eines Werkstattgesprächs in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück vom 24.-26. Oktober 2019 zum künftigen Umgang mit den nationalen Gedenkräumen äußerte die Vertreterin der österreichischen Lagergemeinschaft in deren Auftrag: „…Wir sind uns einig, dass große Veränderungen in der Geschichtsschreibung stattgefunden haben. Jedoch wir wollen unsere Ausstellungsräume in der jetzt vorhandenen Gestaltung erhalten. Für uns handelt es sich um ein Vermächtnis – nicht zuletzt der letzten überlebenden Kameradinnen. Ich nenne sie Kameradinnen, denn als solche bezeichneten sie sich selbst. Die Ausstellungsräume wie sie heute bestehen geben einen Einblick in das politische Geschehen jener Zeit, und wie es so weit kommen konnte, dass solche menschen-verachtenden und menschenunwürdigen Stätten entstanden….Als Kompromiss können wir uns vorstellen, dass neue Gedenkräume in anderen Formen entstehen, doch die Räume im Bunker sollten so, wie sie sind, bestehen bleiben...“
*1. Mitteilungsblatt der ÖLGR vom Juli 1957
*2. ebenda
3. Helga Amesberger, Kerstin Lercher; „Lebendiges Gedächtnis. Die Geschichte der österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück“, mandelbaum Verlag 2008, ISBN 978-3-85476-254-6*

Dr. Broda und Dr. Litschke eröffnen die Ausstellung, Foto: Rainer Mayerhofer

Hermine Jursa bei der Eröffnung der Ausstellung; Foto: Rainer Mayerhofer

Lotte Brainin bei der Eröffnung der Ausstellung, Foto: Rainer Mayerhofer

Rosa Jochmann bei der Eröffnung der Ausstellung, Foto: Rainer Mayerhofer

Toni Bruha bei der Eröffnung der Ausstellung, Foto: Rainer Mayerhofer
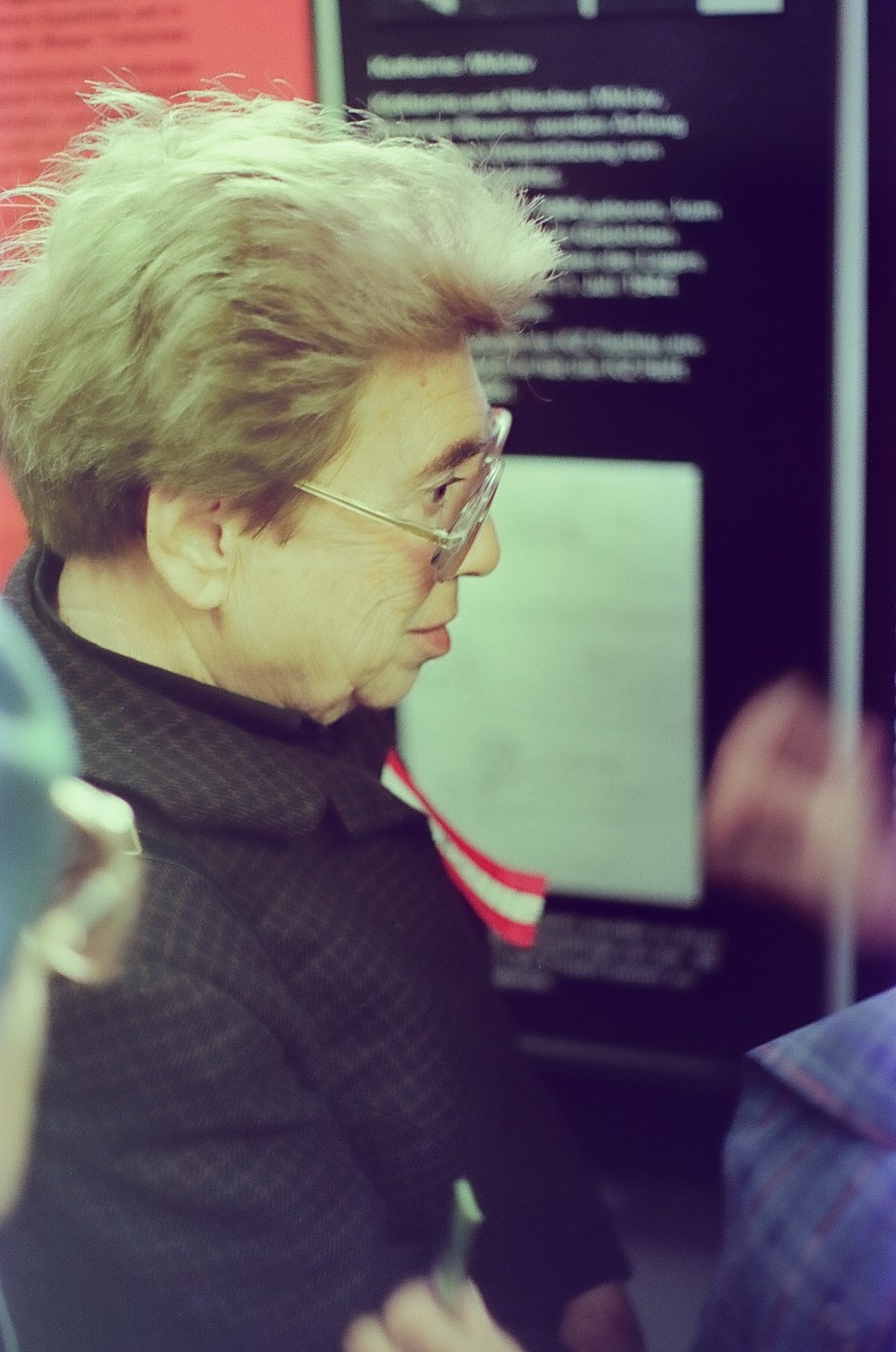
Toni Lehr bei der Eröffnung der Ausstellung, Foto: Rainer Mayerhofer
